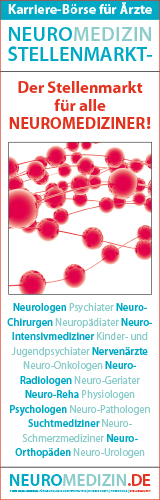Anlässlich des Welttags des Hörens beantwortete Prof. Dr. Mark Praetorius, Stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), Fragen rund um das Thema Schwerhörigkeit und Hörimplantate. In unseren Ohren sortieren und filtern winzige, hochsensible Strukturen die vielfältigen akustischen Signale und verarbeiten sie zu Hörreizen. Ist die Reizübertragung gestört, kann dies zur Beeinträchtigung des Hörens bis hin zu Schwerhörigkeit führen. In Deutschland sind mehr als 16 Prozent der Erwachsenen von Schwerhörigkeit betroffen.
Wie entsteht eine Schwerhörigkeit?
Prof. Dr. Praetorius: Am häufigsten kommt es altersbedingt zu einer Hörminderung im Innenohr. Hier erreichen die Schallwellen der akustischen Signale das mit Flüssigkeit gefüllte Hörorgan – die sogenannte Cochlea. Die Haarzellen in der Cochlea wandeln die Schallsignale in elektrische Impulse um und übermitteln diese in bestimme Hirnareale, sodass wir sie schließlich verstehen. Die Ursachen einer Innenohr-Schwerhörigkeit sind sehr vielfältig. Da spielen zum einen erbliche Faktoren eine Rolle, aber auch chronische Lärmschäden oder Entzündungen können mögliche Ursachen sein. Wenn man eine Hörminderung feststellt, sollte man dies nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern zeitnah untersuchen lassen.
Welche Auswirkungen kann eine Schwerhörigkeit haben?
Prof. Dr. Praetorius: Bleibt eine Schwerhörigkeit unbehandelt, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Zum einen leiden viele Betroffene unter sozialen Problemen, wie beispielsweise Isolation, die durch die Kommunikationsschwierigkeiten auftreten. Darüber hinaus wissen wir aus Studien, dass Schwerhörigkeit im mittleren Lebensalter ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung einer Demenz ist. Wie genau Hörminderungen zur Entwicklung einer Demenz beitragen, ist noch nicht vollumfänglich geklärt. Wahrscheinlich führt der Hörverlust zu einer Dauerbelastung im Hirn. Da sich vermehrt auf das Hören konzentriert werden muss, werden womöglich andere Funktionen des Hirns „vernachlässigt“. Um die Entwicklung einer Demenz zu verhindern, sollte eine Schwerhörigkeit daher frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei einer Schwerhörigkeit?
Prof. Dr. Praetorius: Das kommt ganz darauf an, wie weit die Schwerhörigkeit fortgeschritten ist. Wenn Hörgeräte Patient:innen nicht mehr helfen, Worte ausreichend zu verstehen oder eine vollständige Ertaubung vorliegt, dann kann ein Cochlea-Implantat helfen. Während klassische Hörgeräte wie ein Lautsprecher den Schall verstärken, ahmt ein Cochlea-Implantat die Funktion der geschädigten Struktur im Ohr nach. Ein Mikrofon hinter dem Ohr empfängt den Schall, der in ein digitales Signal umgewandelt wird. Das Signal wird von der Sendespule an die Empfängerspule unter der Kopfhaut weitergegeben, hier werden die Hörnervfasern gereizt. Das Signal wird dann ins Gehirn weitergegeben.
Für wen eignet sich das Cochlea-Implantat und wie wird es eingesetzt?
Prof. Dr. Praetorius: Das Cochlea-Implantat eignet sich für Patient:innen aller Altersgruppen. Das umschließt ebenso schwerhörige Neugeborene oder Kleinkinder wie auch ältere Patient:innen mit starker Schwerhörigkeit. Voraussetzung ist jedoch, dass der Hörnerv aktiv ist und das Gehirn Hören erlernt hat. Ist dies nicht der Fall, etwa bei bereits taub geborenen Personen, kann auch ein Cochlea-Implantat die Verbindung nur in den ersten Lebensjahren herstellen. Das Implantat wird operativ eingesetzt, der Eingriff dauert meist unter zwei Stunden. Die Operation ist unproblematisch und nur in sehr seltenen Fällen mit Komplikationen verbunden.
Und wie sieht die Nachsorge aus?
Prof. Dr. Praetorius: Im UKE setzten wir Cochlea-Implantate nicht nur ein, sondern begleiten die Patient:innen auch intensiv bei der Nachsorge in unserem universitären ambulanten CI-Reha-Zentrum. Denn das neue Hören will gelernt sein: Nach der Operation findet die individuelle Anpassung des Sprachprozessors, der die Signale umwandelt, statt. Oftmals klingen Geräusche zunächst blechern und sehr ungewohnt. Bei einer guten Einstellung stellt sich schon nach wenigen Tagen ein Klang- und Sprachverstehen ein, die Feinanpassung durch die Audiolog:innen erfolgt dann nach und nach.
Quelle: PI UKE
Kontakt für Rückfragen:
Prof. Dr. Mark Praetorius, Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
Martinistraße 52, 20246 Hamburg | Telefon: 040 7410-52360 | m.praetorius@uke.de