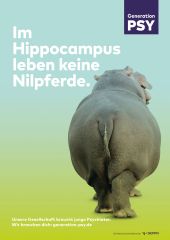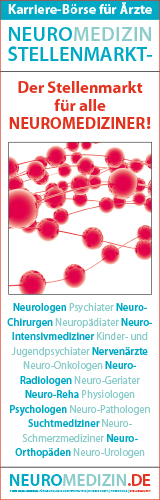Der 23. Kongress des wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM) im Februar 2017 in München stellte die spezifische Therapie dieser Erkrankungsgruppe in den Vordergrund. Therapeutisch öffnen sich viele neue molekulare Optionen zur Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen, deren Langzeiteffektivität aber oft noch offen bleiben muss. „In den letzten 10 Jahren wurden wichtige Fortschritte für neuromuskuläre Erkrankungen erreicht“, betont Kongresspräsident Prof. Dr. Benedikt Schoser, Klinikum der Universität München, Friedrich-Baur-Institut, Neurologische Klinik, Ziemssenstr. „Einerseits durch den enormen Zuwachs an analytisch-genetischer Methodik und Technik (Panel-Diagnostik/Exom-/Genom-Sequenzierung), andererseits durch den Zuwachs in differentieller inflammatorischer Antikörperdiagnostik sind neuromuskuläre Erkrankungen hochspezifisch diagnostizierbar geworden. Erfreulicherweise haben sich parallel moderne symptomatische und molekulare Therapieansätze entwickelt.“ Im Vorfeld der Tagung gab Prof. Schoser in einem Interview einen Einblick in die Fortschritte und Verbesserungen in der Therapie der Neuromuskulären Erkrankungen aller Altersstufen.
Die Pathologie des Muskels und Nervens war über die letzten 50 Jahre der diagnostische Eckpfeiler für die ca. 800 unterschiedlichen neuromuskulären Erkrankungen. Was hat sich inzwischen verändert?
Prof. Schoser: Inzwischen sind für verschiedene Erkrankungen verlässliche Gentest anstelle der Muskel- und Nervenbiopsie getreten. So sind die sogenannten Repeatexpansion- und -deletions Erkrankungen (Myotonie Dystrophien, Okulopharyngeale Muskeldystrophie, Fazioskapulohumerale Muskeldystrophien, Bulbospinale Muskelatrophie, u.a.) nun genetisch zu diagnostizieren. Ebenso werden alle neurogen Prozesse wie z.B. die spinalen Muskelatrophien, Polyneuropathien und die Amyotrophe Lateralsklerose nicht mehr durch eine Muskelbiopsie diagnostiziert. Hier sind die klinisch-neurophysiologische Diagnostik und die molekulare Analytik verlässlicher.
Wie ist das Vorgehen bei den erworbenen Muskelerkrankungen wie inflammatorischen und toxischen Myopathien, oder hereditären Muskeldystrophien, kongenitalen Myopathien, und metabolischen Myopathien?
Prof. Schoser: Für inflammatorische Myopathien hat sich das immer weiter ausweitende Spektrum spezifischer serologischer Antikörper etabliert und hilft uns zu einem besseren Verständnis der Ätiopathogenese der Myositiden und der differentiellen Therapie.
Welchen Stellenwert hat die Elektromyographie und Neurographie für diagnostische Entscheidungen, z.B. für Kinder und Erwachsene mit einem myasthenem oder myotonem Syndrom?
Prof. Schoser: Die Identifikation behandelbarer früh- und spätbeginnender kongenitaler myasthener Syndrome (CMS) z.B. durch Genmutationen in DOK7, GFPT1 DPAGT1, GMPPB bedarf der Elektromyographie in Kombination mit der Dokumentation der Eigenanamnese, der Vorgeschichte und der klinischen Symptome. Die moderne Bildgebung der Muskulatur, je chronischer eine Muskelerkrankung ist, kann zusätzlich diagnostisch wertvolle differentialdiagnostische Hinweise geben, und lässt einen bestmöglichen Muskelbiopsieort bestimmen. Nach Labor, EMG und MRT ist heute schon für viele neuromuskuläre Mediziner die Gen-Panel-Diagnostik, das klinische Exom oder ggf. die Genomanalyse der nächste diagnostische Schritt. Für viele angeborene neuromuskuläre Syndrome ist die Genpanel-Diagnostik oder das klinische Exom/Genom ein Ansatz, der weit über die diagnostischen Möglichkeiten einer konventionellen histopathologischen Diagnostik hinausgeht. Innerhalb der letzten fünf Jahre konnten mehr als 150 Publikationen die Wertigkeit dieser Analysetechniken unter Beweis stellen. Weiterer Fortschritt in der Methode und bioinformatischen Verarbeitung der Datenmengen werden die molekulare Diagnostik weiter verbessern. Nichtsdestotrotz werden wir mit zahlreichen unklaren Sequenzvarianten konfrontiert, deren Pathogenität unklar ist, und die in Genen gefunden werden, die zum Teil primär nicht der Muskulatur zugeordnet werden können. Hier stellt die Muskelbiopsie mit Immunhistologie, In-situ-Hybridierung, Western blotting, Einzelzell-Proteomik, Untersuchung primärer humaner Myoblastenkulturen für die Diagnostik und Verständnis der Pathogenese weiterhin einen sehr wichtigen Baustein dar.
Was sind die Herausforderungen für die molekulare Therapie neuromuskulärer Erkrankungen?
Prof. Schoser: Ziel einer molekularen Therapie neuromuskulärer Erkrankungen ist die Einführung einer funktionell rekombinaten Version des Zielgens. Die Initiierung der Genexpression zur Produktion des Zielproteins kann z.B. durch eine Modifikation der pre-mRNA, wie beim Exonskipping, aus sogenannten Read-through Strategien für Nonsense-Mutationen; aus Zell-basierte Therapien wie bei der Stammzelltechnologie (iPS); auf dem Einsatz von kompensatorischen Proteinen (vgl. Utrophin), aus einer pharmakologischen Therapie mit sogenannten small molecules, und oder aus dem Einsatz von anti-inflammatorischen -/anti-oxidativen Produkten bestehen.
Was sind typische Herausforderungen, die eine Umsetzung in klinische Studien für neuromuskuläre Erkrankungen bisher so schwierig macht?
Prof. Schoser: Zunächst soll spezifisch das Zielorgan, bei neuromuskulären Erkrankungen einerseits der differenzierter Skelettmuskel, insbesondere der Zwerchfellmuskel und auch der Herzmuskel, andererseits der Motoneuron, die Vorderhornzelle, das Spinalganglion oder der periphere Nerv spezifisch erreicht werden. Es besteht die Notwenigkeit eines Langzeittherapieeffekts, da es sich um zumeist hochchronische Erkrankungen handelt, so dass die pharmakologische Sicherheit sehr hoch sein muss. Es gilt eine potentielle Immunantwort zu unterbinden, es muss z.B. bei Muskeldystrophien das Problem der Fibrose des Gewebes berücksichtig werden. Eine spezielle Herausforderung stellt die Notwendigkeit verschiedener „individualisierter“ Versionen der therapeutischen Substanz dar wegen der Vielzahl von unterschiedlichen Genmutationen innerhalb einer genetischen Erkrankung. Therapeutisch öffnen sich viele neue molekulare Optionen zur Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen, deren Langzeiteffektivität aber oft noch offen bleiben muss.
Vielen Dank für das Gespräch.
Autorin: Kerstin Aldenhoff, Conventus