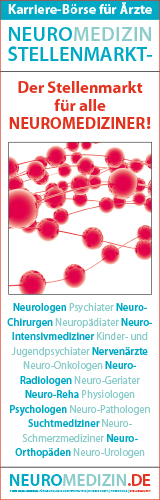Eine Supplementierung mit Testosteron kann bei gesunden Männern bekanntlich zu einer Zunahme der Muskelmasse und -kraft führen. Wissenschaftler der Boston University School of Medicine and Boston Medical Center, Boston, USA, haben nun im Rahmen einer randomisierten plazebokontrollierten Studie untersucht, wie effektiv und sicher eine Testosteron-Behandlung bei älteren Männern mit Mobilitätseinschränkungen ist. Teilnehmer der Studie waren 209 Männer im durchschnittlichen Alter von 74 Jahren mit eingeschränkter Mobilität, die einen Gesamttestosteron-Spiegel im Serum zwischen 100 und 350 ng/dl und einen Serumwert des freien Testosterons unter 50 pg/ml aufwiesen. Die Probanden wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die eine Gruppe ein Testosteron-Gel erhielt, das für einen Zeitraum von sechs Monaten 1 x täglich auf die Haut aufgetragen werden sollte. Der Gruppe 2 wurde für dieselbe Zeit ein plazebohaltiges Gel verabreicht. Alle Patienten wiesen zu Beginn der Studie bereits eine Hypertonie, einen Diabetes, eine Hyperlipidämie und/oder Übergewicht auf. Es zeigte sich, dass sich im Verlauf der Studie in der Testosteron-Gruppe häufiger kardiale, respiratorische und dermatologische Zwischenfälle ereigneten als in der Plazebo-Gruppe. Im Einzelnen traten bei insgesamt 23 Personen, die mit Testosteron behandelt worden waren, jedoch nur bei fünf Probanden, die Plazebo aufgetragen hatten, kardiovaskuläre Nebenwirkungen auf. Das relative Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme blieb während des gesamten halbjährigen Studienzeitraums konstant. Im Vergleich zur Plazebo-Gruppe war bei den mit Testosteron behandelten Männern allerdings eine deutliche Kraftzunahme der Bein- und Brustmuskulatur sowie eine Verbesserung der Fähigkeit zum Treppensteigen unter Belastung zu beobachten. Insgesamt deuten diese Studienergebnisse aber darauf hin, dass ältere Männer mit Mobilitätseinschränkungen und einer hohen Prävalenz an chronischen Erkrankungen durch eine Testosteron-Supplementierung möglicherweise ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Zwischenfällen haben, so die Forscher.
(drs)
Abstract aus N Engl J Med 2010; Vol. 363, pp. 109-122Zurück zur Startseite